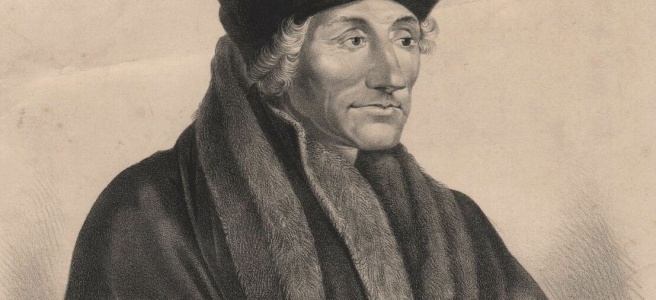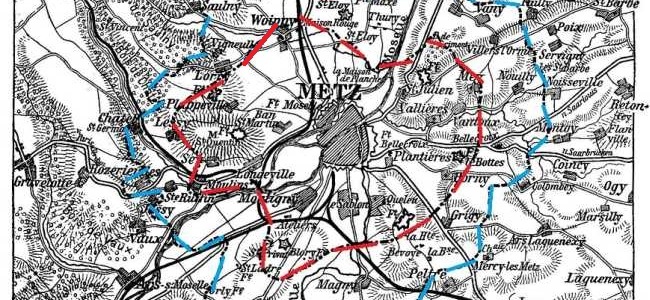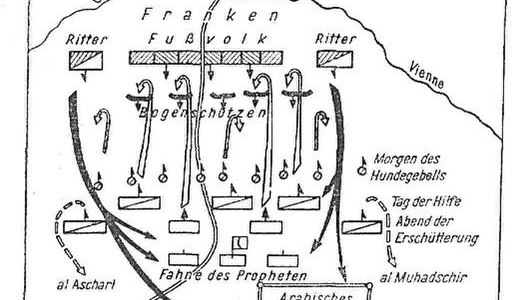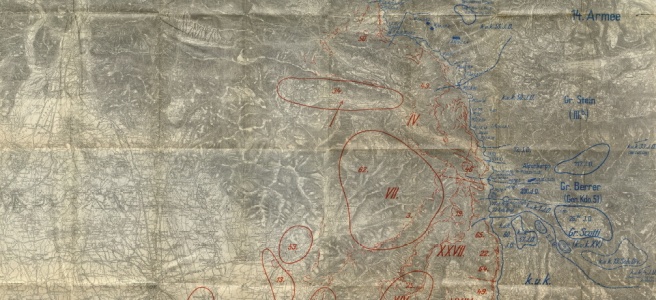Anno 1466 erblickte unser großer deutscher Denker Erasmus von Rotterdam das Licht der Welt. Er selbst nannte sich später Desiderius, was wohl an dem Umstand lag, daß sein Vater Kleriker war und den Pfaffen damals die Eheschließung verboten war. Schelme würden da Arges denken, da ein solches Eheverbot seltsamer Weise das genaue Gegenteil des Ehegebots für die Schriftgelehrten der Selbstauserwählten aus dem Morgenland darstellt. Aber lassen wir das – wenn unser Erasmus auch auf Kriegsfuß mit den besagten Goldstücken stand… Eine Gelehrtenlaufbahn schien ihm beschieden zu sein, aber da unser Erasmus früh seine Eltern verlor und von seinen Vormündern um sein Erbe gebracht wurde, mußte er Mönch werden. Das bescherte ihm zwar die Doktorwürde in der Gotteskunde, leitete sein Denken aber auch auf ungute Bahnen. Mit einem erheblichen Teil seiner 150 Bücher und 2000 Briefe können wir alten Heiden daher nichts anfangen, weil uns christliche Glaubensfragen nicht kümmern. Diese kommen zwar auch in den „Gemeinsamen Gesprächen“ vor, halten sich aber doch in Grenzen – die Plauderei vom Wallfahren lasse ich unseren Erasmus von seinen Werken zum Besten geben: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10576099
„Menedemus.
Was Tausend! Sehe ich da nicht meinen Nachbar Ogygius, der schon seit sechs Monaten niemand mehr zu Gesicht gekommen ist? Es hieß, er sei gestorben. Aber er ist’s wahrhaftig, wenn ich nicht völlig träume. Ich will doch zu ihm hingehen und ihn grüßen. Sei gegrüßt, Ogygius!
Ogygius.
Gleichfalls, Menedemus.
Menedemus.
Welches Land hat dich uns heil wiedergeschenkt? Es ging nämlich hier das böse Gerücht, du hättest die Fahrt über die stygischen Gewässer angetreten.
Ogygius.
Ich bin, dem Himmel sei Dank, inzwischen so gesund gewesen wie kaum je zuvor.
Menedemus.
Möchtest du stets eitles Gerede in dieser Weise Lügen strafen! Aber was hast du denn für Schmuck an? Du bist ja besät mit Muscheln und überall bedeckt mit zinnernen und bleiernen Bildlein und aufgeputzt mit strohgeflochtenen Ketten, und am Arm hast du Schlangeneier Den Vergleich der Rosenkranzkugeln mit Schlangeneiern wird man verstehen.
Ogygius.
Ich habe den heiligen Jakobus in Campostella besucht und dann, von dort heimgekehrt, die bei den Engländern hochberühmte Jungfrau Maria beim Meere Diese Virgo Parathalassia ist die Muttergottes von Walsingham.. Diese habe ich vielmehr neuerdings besucht, denn ich war schon vor drei Jahren dort.
Menedemus.
Aus Herzensneigung, nehme ich an.
Ogygius.
Ja, aus Andacht.
Menedemus.
Ich denk‘, diese Frömmigkeit haben dich die griechischen Autoren gelehrt.
Ogygius.
Die Mutter meiner Frau hatte das Gelübde getan: wenn ihre Tochter einen Knaben gebären werde, so solle ich den heiligen Jakob in eigener Person begrüßen und ihm dafür danken.
Menedemus.
Hast du den Heiligen nur in deinem und deiner Schwiegermutter Namen begrüßt?
Ogygius.
Im Namen der ganzen Familie.
Menedemus.
Ich bin der Ansicht, es wäre deiner Familie um nichts weniger gut ergangen, wenn du den Jakobus ungegrüßt gelassen hättest. Aber, bitte sag‘ mir, was er auf deinen Dank geantwortet hat.
Ogygius.
Nichts; aber wie ich ihm meine Gabe darreichte, schien er zu lächeln und leicht mit dem Kopfe zu nicken; zugleich hielt er mir diese Muschelschale hin.
Menedemus.
Warum schenkt er dergleichen lieber als etwas anderes?
Ogygius.
Weil er daran Überfluß hat bei der Nähe des Meeres.
Menedemus.
O was für ein gütiger Heiliger, der einerseits den Gebärenden Hebammendienste leistet, andrerseits um die Fremden sich bemüht! Aber ist denn das eine neue Art Gelübde, daß ein Müßiger anderen die Arbeit aufladet? Wenn du dich durch ein Gelübde verpflichtetest, ich werde für den Fall, daß dein Vorhaben gut ausfalle, zweimal in der Woche fasten, glaubst du, daß ich das tun würde, was du gelobt hast?
Ogygius.
Ich glaube es nicht, selbst wenn du in deinem eigenen Namen es gelobt hättest. Denn dir macht es Spaß, den Heiligen etwas um den Mund zu schmieren. Aber hier handelt es sich um meine Schwiegermutter; da hieß es gehorchen. Du kennst die Begehren der Frauen, und auch mir war daran gelegen.
Menedemus.
Wenn du das Gelübde nicht gehalten hättest, was für eine Gefahr wäre dabei gewesen?
Ogygius.
Der Heilige konnte mich allerdings nicht vor Gericht fordern, das ist richtig; aber er konnte künftighin gegenüber meinen Wünschen taub sein oder in aller Stille irgend ein Unheil über meine Familie schicken. Du kennst die Art der großen Herren.
Menedemus.
Sag‘ mir: wie steht’s und geht’s mit dem vortrefflichsten Manne Jakobus?
Ogygius.
Weit schlechter als früher.
Menedemus.
Woher kommt das? Von Altersschwäche?
Ogygius.
Du Schwätzer! Du weißt doch, daß die Heiligen nicht alt werden. Aber dieser neue Glaube, der sich weithin über den Erdkreis verbreitet, bewirkt, daß er weniger häufig als sonst begrüßt wird; und wenn Leute kommen, so grüßen sie nur, geben aber nichts oder nicht der Rede wert, mit der Bemerkung, dieses Geld werde besser den Armen zugewendet…“