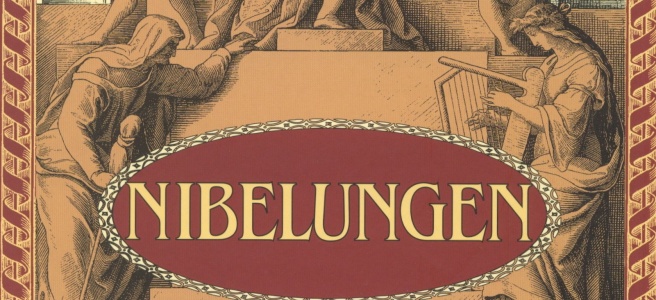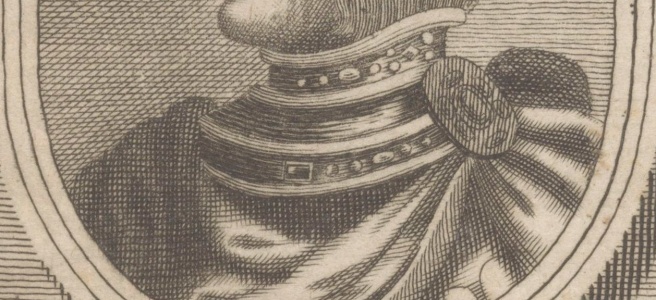Das Nibelungenlied, unser deutsches Nationalepos aus dem hohen Mittelalter, wurde 1755 von unserem Gelehrten Hermann Obereit wiederentdeckt. Gefunden hat er dessen Handschrift in der Bücherei des Schloßes Hohenems. Unser deutsches Rittertum wird in dessen 39 Gesängen (Abenteuer) wunderbar besungen und obendrein schuf unser Tondichter Richard Wagner seinen Ring auf Grundlage unseres Nibelungenliedes. Wie auch so mancher deutscher Dichter gar sehr von den Heldentaten unserer Burgunder begeistert worden sind. Mit „Der Held des Nordens“ steuerte unser Dichter Friedrich Fouque auch ein Stück zur Nibelungendichtung bei: http://www.zeno.org/Literatur/M/Fouqu%C3%A9,+Friedrich+de+la+Motte/Drama/Der+Held+des+Nordens Anläßlich seiner glücklichen Heimkehr aus Island veranstaltet unser Burgunderkönig Gunther am Rhein ein großes Ritterspiel: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Simrock/sim_ni00.html
„Jenseits des Rheins sah man dem Gestad
Mit allen seinen Gästen den König schon genaht.
Da sah man auch am Zaume leiten manche Maid:
Die sie empfangen sollten, die waren alle bereit.
Als bei den Schiffen ankam von Isenland die Schar
Und die der Nibelungen, die Siegfried eigen war,
Sie eilten an das Ufer; wohl fliß sich ihre Hand,
Als man des Königs Freunde jenseits am Gestade fand.
Nun hört auch die Märe von der Königin,
Ute der reichen, wie sie die Mägdlein hin
Brachte von der Veste und selber ritt zum Strand.
Da wurden mit einander viel Maid‘ und Ritter bekannt.
Der Markgraf Gere führte am Zaum Kriemhildens Pferd
Bis vor das Thor der Veste; Siegfried der Degen wert
Durft ihr weiter dienen; sie war so schön und hehr.
Das ward ihm wohl vergolten von der Jungfrau nachher.
Ortwein der kühne führte Ute die Königin,
Und so ritt mancher Ritter neben den Frauen hin.
Zu festlichem Empfange, das mag man wohl gestehn,
Wurden nie der Frauen so viel beisammen gesehn.
Viel hohe Ritterspiele wurden da getrieben
Von preiswerten Helden (wie wär es unterblieben?)
Vor Kriemhild der schönen, die zu den Schiffen kam.
Da hub man von den Mähren viel der Frauen lobesam.
Der König war gelandet mit fremder Ritterschaft.
Wie brach da vor den Frauen mancher starke Schaft!
Man hört‘ auf den Schilden erklingen Stoß auf Stoß.
Hei! reicher Buckeln Schallen ward im Gedränge da groß!
Vor dem Hafen standen die Frauen minniglich;
Gunther mit seinen Gästen hub von den Schiffen sich:
Er führte Brunhilden selber an der Hand.
Wider einander leuchtete schön Gestein und licht Gewand.
In höfischen Züchten hin Frau Kriemhild ging,
Wo sie Frau Brunhilden und ihr Gesind empfing.
Man konnte lichte Hände am Kränzlein rücken sehn,
Da sich die Beiden küssten: das war aus Liebe geschehn.
Da sprach wohlgezogen Kriemhild das Mägdelein:
„Ihr sollt uns willkommen in diesem Lande sein,
Mir und meiner Mutter, und Allen, die uns treu
Von Mannen und von Freunden.“ Da verneigten sich die Zwei.
Oftmals mit den Armen umfingen sich die Fraun.
So minniglich Empfangen war nimmer noch zu schaun,
Als die Frauen beide der Braut da taten kund,
Frau Ute mit der Tochter: sie küssten oft den süßen Mund.
Da Brunhilds Frauen alle nun standen auf dem Strand,
Von waidlichen Recken wurden bei der Hand
Freundlich genommen viel Frauen ausersehn.
Man sah die edeln Maide vor Frau Brunhilden stehn.
Bis der Empfang vorüber war, das währte lange Zeit,
Manch rosigem Munde war da ein Kuß bereit.
Noch standen bei einander die Königinnen reich:
Das freuten sich zu schauen viel der Recken ohne Gleich.
Da spähten mit den Augen, die oft gehört vorher,
Man hab also Schönes gesehen nimmermehr
Als die Frauen beide: das fand man ohne Lug.
Man sah an ihrer Schöne auch nicht den mindesten Trug.
Wer Frauen schätzen konnte und minniglichen Leib,
Der pries um ihre Schöne König Gunthers Weib;
Doch sprachen da die Kenner, die es recht besehn,
Man müsse vor Brunhilden den Preis Kriemhilden zugestehn.
Nun gingen zu einander Mägdelein und Fraun;
Es war in hoher Zierde manch schönes Weib zu schaun.
Da standen seidne Hütten und manches reiche Zelt,
Womit man erfüllt sah hier vor Worms das ganze Feld.
Des Könige Freunde drängten sich, um sie zu sehn.
Da hieß man Brunhilden und Kriemhilden gehn
Und all die Fraun mit ihnen hin, wo sich Schatten fand;
Es führten sie die Degen aus der Burgunden Land.
Nun waren auch die Gäste zu Ross gesessen all;
Da gabs beim Lanzenbrechen durch Schilde lauten Schall.
Das Feld begann zu stäuben, als ob das ganze Land
Entbrannt wär in der Lohe: da machten Helden sich bekannt.
Was da die Recken taten, sah manche Maid mit an.
Wohl ritt mit seinen Degen Siegfried der kühne Mann
In mancher Wiederkehre vorbei an dem Gezelt;
Der Nibelungen führte tausend Degen der Held.
Da kam von Tronje Hagen, wie ihm der König riet;
Der Held mit guter Sitte die Ritterspiele schied,
Daß sie nicht bestaubten die schönen Mägdelein:
Da mochten ihm die Gäste gerne wohl gehorsam sein.
Da sprach der edle Gernot: „Die Rosse laßt stehn,
Bis es beginnt zu kühlen, daß wir die Frauen schön
Mit unserm Dank geleiten bis vor den weiten Saal;
Will dann der König reiten, find er euch bereit zumal.“
Das Kampfspiel war vergangen über all dem Feld:
Da gingen kurzweilen in manches hohe Zelt
Die Ritter zu den Frauen um hoher Lust Gewinn:
Da vertrieben sie die Stunden, bis sie weiter sollten ziehn.
Vor des Abends Nahen, als sank der Sonne Licht
Und es begann zu kühlen, ließ man es länger nicht:
Zu der Veste huben Fraun und Ritter sich;
Mit Augen ward geliebkost mancher Schönen minniglich…“